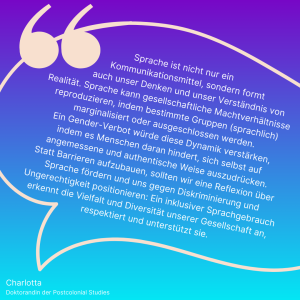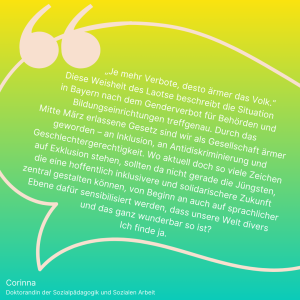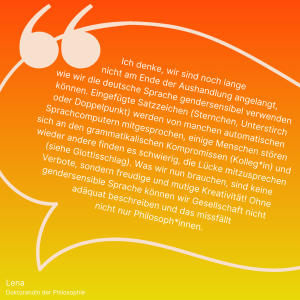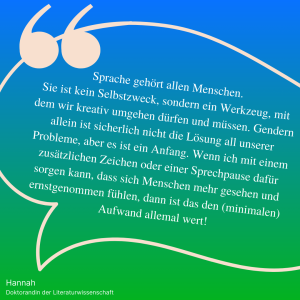Von Aileen Bierbaum, Hannah Berger, Katharina Deufel, Lena Schützle,
Corinna Beckers, Charlotta Sophie Sippel, René Pikarski und Mareike Ochs
Als engagierte Wissenschaftler:innen eines bayerischen Promotionskollegs möchten wir die „Zeichen der Zeit“ nicht nur lesen, sondern auch klare Zeichen setzen: Gegen die Diskriminierung und Marginalisierung von Minderheiten und für eine gleichberechtigte, inklusive und tolerante Gesellschaft. Diesen Anspruch verfolgen auch jene, die mehrgeschlechtliche Schreibweisen durch Wortbinnenzeichen verwenden. An diesen Zeichen scheiden sich derzeit allerdings die Geister, sie entfachen Debatten, erhitzen die Gemüter und verhärten die Fronten. Dabei wollen sie doch eigentlich das Gegenteil bewirken: Verbindungen stiften, Sichtbarkeit schaffen, Verletzung reduzieren. Gendersensible Doppelpunkte, Unterstriche und Sternchen provozieren ein Innehalten im Sprechen und eröffnen Räume für die Reflexion eingefahrener Denkgewohnheiten. Einige empfinden das als unschön, unbequem und unnötig. Für andere ist dieser bewusste Wandel der Sprache unerlässlich, um den Herausforderungen und Chancen unserer liberalen und demokratischen Gesellschaft gerecht zu werden. In Anerkennung der vielseitigen Positionen dieser längst nicht abgeschlossenen Debatte fragen wir uns hier in Form persönlicher Meinungen, wie sich das in Bayern beschlossene Gendersprachverbot dazu verhält. Damit kommen weder die Position der an unserem Kolleg beteiligten Hochschulen noch Stiftungen zum Ausdruck.
—————————————
Von Aileen Bierbaum, Doktorandin der Soziologie
„Ihr könnt uns nicht weg reden, indem ihr nicht mehr von uns sprecht.” – Unter diesem Motto fand am 24. März in München eine Demonstration gegen das am 19. März 2024 durch das bayerische Kabinett erlassene Gesetz statt, welches die Verwendung gendersensibler Sprache an Behörden, Schulen und Hochschulen verbietet.
Das erlassene Gesetz ist vor allem eines: diskriminierend. Während geschlechtergerechte Sprache für eine offene Gesellschaft steht, welche ihre Diversität und Pluralität in ebendieser ausdrückt, suggeriert ein Gesetz wie dieses, dass die Gesellschaft vor Diversität geschützt werden müsse. Es widerspricht nicht nur dem Erziehungs- und Bildungsauftrag von Schulen und Hochschulen, es diskriminiert aktiv ohnehin schon marginalisierte Gruppen und bedeutet einen Rückschritt in Bezug auf die Akzeptanz geschlechtlicher Vielfalt auf verschiedensten Ebenen.
Als Sozialpädagogin, Promovendin in der Soziologie, Dozentin für Gender-Studies an einer Hochschule und queere Person empfinde ich das Verbot auf unterschiedlichen Ebenen als unangemessen und rückschrittlich, vor allem aber als Eingriff in die Menschlichkeit und Angriff auf die Möglichkeit, durch Sprache eine Realität zu schaffen, in welcher sich Menschen durch eine kleine Sprechpause, ein Gendersternchen oder einen Doppelpunkt mitgemeint, akzeptiert und weniger diskriminiert fühlen.
In einer im Dezember 2023 veröffentlichten repräsentativen Studie des Bayrischen Jugendrings und dem Institut für Diversity- und Antidiskriminierungsforschung wurden LGBTIQA*-Jugendliche und junge Erwachsene in Bayern zu ihrer Lebenssituation befragt. 94% der befragten Personen gaben an, schon einmal Diskriminierung erfahren zu haben. Dabei geben 49% aller Befragten an, mit falschen Namen/Pronomen angesprochen worden zu sein und 79% empfinden die fehlende Sichtbarkeit in Lehrmaterialien als diskriminierend. Eine Zahl, die durch das Genderverbot wohl noch steigen wird.
Die binäre Geschlechterordnung kann und muss hinterfragt und dekonstruiert werden, denn wie wir seit vielen Jahren wissen, gibt es nicht nur zwei Geschlechter. Inter* und trans* Personen werden durch Gesetze wie dieses diskriminiert, ausgegrenzt, ihrer Identität beraubt und letztlich vor allem unsichtbar gemacht. Eine Unsichtbarkeit, die durch zunehmende Repräsentation in Medien oder Politik (2021 zogen mit Tessa Ganserer und Nyke Slawik die ersten trans* Personen in den Bundestag ein) und gesetzliche Regelungen, wie die Möglichkeit des Geschlechtseintrags ‘divers’ und die geplante Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes in den vergangenen Jahren schon deutlich abgebaut werden konnte.
Dass Gendern in der Sprache für den Einschluss marginalisierter Gruppen unabdingbar ist, ist wahrscheinlich vielen bewusst. Genauso, wie es denen, die bereits in Wort und Schrift gendern, bewusst ist, dass dies nicht alle Menschen tun werden. Dennoch geht es um den Versuch, sich einer Sprache anzunähern, die alle mit meint, statt nur diejenigen, die sich im binären Geschlechtersystem verorten können. Und da ist die Diskussion um die Verwendung des generischen Maskulinums in dieser Wortmeldung noch nicht einmal inbegriffen. Jede Person sollte sprechen können dürfen, wie sie es für richtig hält.
—————————————
Von René Pikarski, Doktorand in der politischen und Sozialphilosophie
Nicht Verbote, sondern Diskurse halten Diskurse offen
Es dauert eine ganze Weile, bis wir Bürger:innen uns im Strukturbaum der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern (AGO) bis zum §22 durchgeklickt haben. Er regelt die sprachliche Gestaltung des dienstlichen Schriftverkehrs und gehört damit zu den Ablaufbestimmungen von Behördenprozessen, die stets »allgemeinwohlbezogen, zielorientiert, wirtschaftlich und sparsam, bürgerfreundlich, umweltgerecht, sozialverträglich und mitarbeiterbezogen zu erfüllen« sind. Der Bayerische Brief soll dabei »höflich, klar und für den Empfänger« (wohl nicht für die Empfängerin) »verständlich sein sowie Fremdwörter möglichst vermeiden«, Anliegen sachgerecht und nachvollziehbar begründen und dabei die betreffenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften einheitlich zitieren sowie Abkürzungen stehts für den Bürger (wohl nicht für die Bürgerin) erklären. Es gelten dabei die amtlichen Regeln der deutschen Rechtschreibung und eine ab dem 1. April 2024 wirksame Ergänzung: “Mehrgeschlechtliche Schreibweisen durch Wortbinnenzeichen wie Genderstern, Doppelpunkt, Gender-Gap oder Mediopunkt sind unzulässig.”
Der Ministerrat begründet diese Ergänzung damit, dass man einer Empfehlung des Rates für deutsche Rechtschreibung aus dem vergangenen Jahr folge, nach der entsprechende »Eingriffe in Wortbildung, Grammatik und Orthografie« »die Verständlichkeit von Texten beeinträchtigen können«. Die Änderung der AGO auf diese Empfehlung zu stützen, erscheint mir argumentativ wenig überzeugend und opportun. Dies verrät etwa der etwas ungeschickt-ehrliche Verweis, dass man sich zwar an dieser Empfehlung des Rechtschreib-Rates orientiere, die Änderungen in der AGO aber auch dann noch gelten werden, wenn der Rat in »etwaigen künftigen Entscheidungen« zu einer anderen Auffassung kommen sollte. Eine Argumentation ist kaum überzeugend, sofern es sich auf eine Autorität beruft, die es im gleichen Moment nicht als Autorität anerkennt. Auf diese Weise ist eine demokratisch angemessene Begründungsaufgabe nur unzureichend erfüllt, die ich eigentlich zu den Stärken unseres politischen Handelns in seinem öffentlichen, streitfreudigen Wesen zähle.
Bemerkenswert ist, dass sich der Rat für deutsche Rechtschreibung bei seiner Empfehlung zwar ebenfalls auf das genannte Argument der Sprachverständlichkeit stützt. Allerdings betont er zugleich, dass jede politische Adaption dieser Empfehlung etwa in verwaltungsrechtlichen Regeln die Sprachverständlichkeit immer auszubalancieren habe mit der unbestreitbaren gesellschaftspolitischen Bedeutung einer gendersensiblen Sprache, beispielsweise im Hinblick auf ihren antidiskriminierenden Anspruch, genauer: einem Ansprechen und Sichtbarmachen ansonsten exkludierter und marginalisierter Personen und Personengruppen. Ich verstehe diesen Hinweis so, dass im Konfliktfall eine Regelung zugunsten der Sprachverständlichkeit nicht und niemals ohne vernünftige Abwägung gegenüber diesem gesellschaftspolitischen Nutzen gendersensibler Sprache erfolgen sollte.
Von dieser Ausbalancierung, von der Berücksichtigung der positiven gesellschaftlichen Bedeutung gendergerechter Sprache, fehlt in der knappen Begründung des Ministerialbeschlusses leider jede Spur. Zudem setzt sich der Ministerrat über eine Warnung des Rats für deutsche Rechtschreibung hinweg, dass politische Regulierungen unserer Sprache und erst recht ein Sprachverbot zur Folge haben könnten, einen derzeit noch offenen Diskurs auf radikale Weise zu kanalisieren und ihn über die Bürger:innen, die an diesem Pro- und Kontra-Diskurs teilnehmen, hinweg frühzeitig zu beenden. Und das, obwohl »geschlechtergerechte Schreibung« »aufgrund des gesellschaftlichen Wandels und der Schreibentwicklung noch im Fluss« ist.
Dass die Begründung des Ministerrats (das Genderverbot diene der Sprachverständlichkeit) opportun ist, könnte man auch aus den nachträglichen Statements beteiligter Politiker (in dem Fall nur Männer) ableiten. Sie beziehen sich nämlich weniger auf die Sprachverständlichkeit, sondern darauf, dass man endlich einer »ideologiegetriebenen« Sprache im dienstlichen Schriftverkehr Einhalt gebiete, die längst schon diskriminierende und moralisierende Effekte gezeigt habe, und zwar gegenüber denjenigen, die nicht gendern. Daher diene das Genderverbot nun dazu, »die Diskursräume in einer liberalen offenen Gesellschaft tatsächlich offenzuhalten und nicht weiter zu verdrängen«.
Ich kann nicht dazu Stellung nehmen, inwieweit diese Einzelfälle (auch in ihrem Verhältnis zu den durch gendersensible Sprache erreichten Personen) ausschlaggebend sein können für ein Sprachverbot. Mich irritiert allerdings, dass hier der Diskurs über die sowohl positive wie negative gesellschaftspolitische Bedeutung einer gendersensiblen Sprache von den politischen Akteuren im Raum der öffentlichen, oft und sicher auch zurecht nur locker bis schlecht begründeten Meinungen zwar weitergeführt und angefeuert wird. Doch offenbar mangelte es im selben Fall an politischem Engagement, diese Meinungen vorher auch auf ein begründungswürdiges Niveau für die beschlusswirksame Ebene und die eigentliche politische Handlung zu heben. Dort, wo es nicht nur um Wählerstimmen und Parteidebatten geht, sondern um die zukünftige Gestaltung unserer Institutionen, Behörden und Hochschulen; dort, wo die eigentliche Action ist, in der Begründung eines Verbots, findet überhaupt kein gesellschaftspolitisches Argument zum Gendern statt. Weder geht es um Diskriminierung noch um Gerechtigkeit. Man begnügt sich mit dem Hinweis auf die verständliche Sprache. Das erscheint mir, im Doppelsinn des Wortes, doch etwas faul.
Ohne ein überzeugendes Argument bleibt also fragwürdig, wie nun ausgerechnet Verbote einen Diskurs offenhalten können. Es mag sein, dass wir beim gendersensiblen Sprechen noch keine letzte, überzeugende Form gefunden haben. Aber die Suche auf institutioneller Ebene in Behörden, Schulen und Hochschulen nun durch ein Verbot als beendet zu erklären und diesen öffentlichen Raum und seine Vertreter:innen ins Abseits eines gesamtgesellschaftlich ohnehin und trotzdem weitergehenden Diskurses zu stellen, scheint mir ein unangebrachtes Mittel zu sein, um überhaupt irgendwelche Diskurse offenzuhalten.
Verständlichkeit und Verständigung durch Sprache
Meinem Appell für eine würdevolle Argumentation bei politischen Entscheidungen zur gendersensiblen Sprache, die allen Betroffenen und unserer Demokratie angemessen ist, möchte ich ein Plädoyer dafür anschließen, den unentschiedenen Diskurs über einen entsprechenden Wandel unserer Sprache nicht durch Verbote zu kanalisieren.
Als Geisteswissenschaftler, der gendersensibel schreibt und spricht, gebe ich gern die Unbequemlichkeit zu: Ich beneide diejenigen, die bereits intuitiv gendern. Mir aber rutscht, gerade bei Vorträgen, die ausschließlich maskuline Form noch hin und wieder durch. Ich habe dabei kaum die Erfahrung gemacht, dass man mich dafür moralisierend tadelt, geschweige denn aus dem Diskurs verdrängt. Wenn überhaupt, ertappe ich mich selbst dabei und hole die angebrachte Anrede nach. Ich störe mich daran selbst und bin der Meinung, dass diese Störung für mich sinnvoll ist.
Bis jetzt hat mich niemand davon überzeugt, dass mit einem ungewöhnlichen Doppelpunkt oder einer gendersensiblen Pause im Sprechen ein derart krasses Sprach-un-verständnis erzeugt würde, welches sich auch nur ansatzweise mit dem gesellschaftspolitischen Nutzen eines gendersensiblen Sprachwandels messen kann. Manchmal denke ich: Wenn auch nur eine einzige Person sich durch eine veränderte, bewusst gerichtete Anrede in meiner Umwelt gerechter behandelt fühlt oder dadurch sichtbarer wird, was juckt mich da angesichts der von mir hochgeschätzten Werten wie Gerechtigkeit und Solidarität eigentlich eine winzige Störung, Unterbrechung, Veränderung im Sprachfluss und eine entsprechend kleine grammatikalische Delinquenz? Ich habe bisher in keiner Behörde und in keiner Hochschule jemanden angetroffen, deren oder dessen Intellekt und Sprachfähigkeit durch einen Genderstern überfordert und vor den reißenden Abgrund der Sprachverwirrung gebracht wurde. Stattdessen kenne ich Menschen, die sich dadurch gerechter angesprochen und wahrgenommen fühlen.
Für mich genießt unsere Grammatik keinen Wert an sich, den es in Ewigkeit zu konservieren gilt. Ihr Wert, wie der der Sprache insgesamt, muss sich andauernd an der Verständlichkeit und am Nutzen der Verständigung messen lassen. Das Gendern ist dabei ein relativ aufwandsgeringes Mittel, um Personengruppen, die bisher sprachlich unzureichend abgebildet waren, endlich abzubilden, denn das heißt: sie in unsere Verständigungsbeziehungen ausdrücklich einzubeziehen. Das allein kann natürlich auch die Regelung leisten, beide Geschlechter gleichberechtigt nebeneinander anzuschreiben. Aber der aktivierende, diese Beziehung überhaupt erst behauptende und damit etablierende Schritt, die Signalwirkung, aber auch das Signal der so Sprechenden, sich hier zu etwas zu bekennen; jenes bewusst initiierte Stolpern, das das Bewusstsein ändern soll, scheint mir insbesondere in der Transgression der Grammatik zu liegen. Hinzu kommt, dass in diesem Signal der Pause, des Doppelpunkts und Sterns kein Graben der Unverständlichkeit, sondern die Chance lauert, mehr als nur zwei Geschlechter anzusprechen.
In diesem Sinne ist das Gendern immer »politisch«, aber nicht in jedem Fall »ideologisch« (d. i. weltanschaulich ohne Weltbezug). Ich fände die Unterstellung unplausibel, dass der weltanschauliche Gehalt meines Genderns weltfremd und in seinen wahren Motiven missionarisch verschleiert sei. Denn ich benenne klar meine Agenda und kann auf Tatsachen in der Welt, auf tatsächliche und faktische Ungerechtigkeiten und Machtverhältnisse verweisen, die auch von der Sprache und unseren Wissensstrukturen erzeugt und gestützt werden. Für mich ist genau dieses Aufzeigen ein wissenschaftlicher und kein ideologischer Erfolg vieler soziologischer Studien und machtkritischer Diskursanalysen und Genealogien etwa in den Gender- und Queerstudies.
Ich gendere deshalb, weil ich davon überzeugt bin, dass Sprache und Symbole ein wesentliches Mittel von Macht und Gewalt sein können und somit ihr Wandel für den Widerstand und die Veränderung oder Überwindung sozialer Ungerechtigkeiten unerlässlich ist. Wenn unsere Sprache in einem Fluss ist und diese Transformationen oft politisch motiviert und strategischen Eingriffen ausgesetzt sind, egal, ob nun durch gendersensible Anregungen oder Gendersprachverbote, dann ist nicht die Frage ob, sondern wie, auf welche Weise wir an diesem Prozess mitwirken wollen. Ob affektiv, intuitiv, mit guten oder schlechten Argumenten, das macht doch einen Unterschied, auch in der Akzeptanz dieses Wirkens, das jeden politischen Opportunismus und jede Finalität meiden sollte.
Ich denke, dass die angesprochenen Geisteswissenschaften sehr gute Gründe für eine Veränderung der Sprache genannt haben, mit denen wir uns politisch nicht immer ausreichend beschäftigen, wenn wir nur darauf verweisen, wie sehr oder vielmehr wie gering wir uns von diesen Veränderungen im Sprechen und Verstehen gestört fühlen oder wenn wir Gendersensibilität vorschnell als »Ideologie« ausweisen. Es besteht zudem die Gefahr, dass eine entsprechende Gegenmaßnahme, erst recht, wenn es sich um ein Verbot handelt, das selbst nicht gut begründet ist, sich wiederum dem Ideologieverdacht und vollkommen zurecht der Ideologiekritik aussetzen muss. Der Weg zu einer guten Begründung würde über die oben angesprochene Ausbalancierung führen: Wenn wir von der wichtigen Aufgabe der Verständlichkeit unserer Sprache reden, wären wir vielleicht gut beraten, darunter nicht nur die Lesbarkeit und den reibungsfreien Sprachfluss unser Sätze zu verstehen, sondern auch den Fluss, mit dem sich unsere Sprache wandelt, um unsere Verständigung besser und gerechter zu machen.
Politik mit anstatt gegen Sprache
Letztlich macht mir noch ein weiterer Umstand Sorgen, der gegenüber dem Gendern allgemeiner liegt, wenn überhaupt regulierend auf die Weise Einfluss genommen wird, wie ich öffentlich zu schreiben und zu sprechen habe. Drückt nicht jede Regelung, nicht jedes Verbot auch ein wachsendes Misstrauen der Politik gegenüber Lehrenden und Forschenden aus? Als Geisteswissenschaftler und im Sinne der Freiheit meiner Forschung und Lehre gehört zu meinem methodischen Handwerk, zu meinem Werkzeugkoffer, nun einmal wesentlich ein freier Umgang mit der Sprache. Ich bin auf sie angewiesen. Ich schreibe und rede mit der Sprache, auch gegen die von ihr mitproduzierten Missverhältnisse. Ich benutze die Sprache dafür, um etwas zu verändern, um neue Erkenntnisgegenstände auszudrücken, semantische oder auch ontologische Beziehungen sichtbar (also sagbar) zu machen, die vorher womöglich verdeckt und unsichtbar waren.
Geisteswissenschaften, die nicht nur beschreiben, wie die Welt ist und wie die Dinge stehen, sondern wie unser Forschungskolleg »Zeichen der Zeit lesen« Impulse für soziale Transformationen zu geben, müssen als demokratische Institution von unserer liberalen Gesellschaft darin unterstützt werden, Änderungen in der Art und Weise, wie wir denken und sprechen, zuzulassen. Wir sollten uns gerade deshalb vor Sprachverboten hüten, weil ein Verbot an sich selten eine sensible Maßnahme darstellt für hochsensible Fragen danach, wer sich wie von einer Weise zu sprechen ausgegrenzt und benachteiligt erlebt. Innerhalb der Sprache findet unsere gegenseitige Kritik statt: Wen habe ich mit meinen Sätzen vernachlässigt? Wen habe ich damit pauschal klassifiziert, wen habe ich damit verletzt? Wen habe ich auch ohne böse Absicht aus- oder unfair durch eine sprachliche Identifikationsleistung eingeschlossen? Es macht für mich als Wissenschaftler doch einen Unterschied, ob ich diese Kritik öffentlich unter dem Damoklesschwert eines endgültigen Verbots oder entlang der für jeden Diskurs geltenden, aber doch nie abschließend ausgehandelten Kommunikationsnormen führe. Lasst uns doch in diesem Sinne Politik mit Sprache, aber nicht Politik gegen Sprache machen.
Für mich geht es darum, den politischen Umgang mit Sprache vor allem als solidarische Praxis oder als Stiftung solidarischer Beziehungen mit den Unsichtbaren und Ausgeschlossenen, symbolisch unzureichend Repräsentierten mit Leben zu füllen. Das aber ist für mich nicht nur ein politischer Inhalt, sondern ein genuin wissenschaftlicher Anspruch. Geht es der Wissenschaft nicht genau darum, Dinge und Zusammenhänge zu erkennen, die vorher unbekannt, ungesehen und ungesagt waren? Es ist vielleicht keine gute Idee, den Wissenschaften ihren ureigenen Operationsmodus und das dazugehörige neugierige Ethos über ein Sprachverbot zum Beispiel in der Lehre zu beschneiden. Wie soll ich adäquat zwischenmenschliche Verhältnisse kritisieren oder dazu einladen, ohne auch die symbolischen Formen aufzudecken und zu kritisieren, ohne die sie nicht denk- und abbildbar sind? Wie soll das ohne Transgression und Veränderung der Sprache gehen? Mir leuchtet nicht ein, was man eigentlich von der Geisteswissenschaft verlangt, wenn man ihr institutionell neue und kreative Sprachformen verbietet, anstatt sie als Vorschlag in einem kritischen Diskurs offen zu halten und dort die Pros und Kontras gemeinsam mit der interessierten Öffentlichkeit auszuhandeln und sie entlang der Maßstäbe von Verstand, Verständlichkeit und Verständigung zu balancieren.